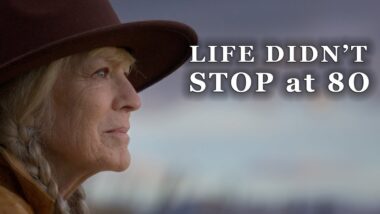Wohnprojekte der Hoffnung

Ein einzigartiges Wohnprojekt in Heidelberg: Studierende haben das Collegium Academicum ins Leben gerufen, ein Wohnheim, das sie selbst finanziert und gestaltet haben. Neben dem Neubau von 2023 gibt es einen Altbau, den die US-Armee genutzt hat, und in dem sogar junge Familien wohnen können.
Finanzierung? 21 Millionen Euro Gesamtvolumen, davon 13,4 Millionen über einen Bankkredit. Der Rest kommt aus Fördermitteln und Direktkrediten von rund 500 Privatpersonen. Und die Selbstverwaltung? Alle treffen regelmäßig Entscheidungen, Arbeitsgemeinschaften organisieren Themen von Mietverwaltung bis Kulturveranstaltungen.
Interview mit einer Bewohnerin bei brand eins hier.
Hintergrund Collegium Academicum von der Webseite
Seit 2013 arbeiten wir als ehrenamtliche Projektgruppe daran, für über 250 Menschen bezahlbaren, selbstverwalteten und ökologisch vertretbaren Wohnraum auf der Heidelberger Konversionsfläche „US Hospital“ zu schaffen. Damit bauen wir direkt auf den Grundgedanken des bis in die 1970er Jahre in der Heidelberger Altstadt existierenden Wohnheims „Collegium Academicum“ (CA) auf: Demokratische Organisation, gesellschaftskritisches Denken, selbstverwaltetes Wohnen und vielfältige Bildungs- und Kulturveranstaltungen.
Zu unserem Projekt zählt ein vierstöckiger Holzneubau, der bezahlbares und selbstbestimmtes Wohnen für Studierende, Auszubildende und Promovierende ermöglicht. Die ersten 176 Bewohner*innen des Holzneubaus sind im Februar 2023 eingezogen.
Daneben startete in dem angrenzenden Bestandsgebäude Anfang 2024 der erste Jahrgang unseres Orientierungsjahres falt*r, in dem die Teilnehmenden in Gemeinschaft wohnen und lernen. Ergänzend haben wir in diesem Gebäude acht Wohnungen geschaffen, davon sechs im mietpreisgebundenen sozialen Wohnungsbau. Die beiden großen Gebäude werden durch ein ehemaliges Pförtnerhäuschen ergänzt, das saniert werden soll, um dann den Bewohner*innen und dem Stadtteil als Treffpunkt offenstehen zu können.
Integration durch gemeinsames Wohnen: Hoffnungshäuser
Die Hoffnungshäuser zeigen: Wenn Menschen zusammenleben, anstatt getrennt zu bleiben, entsteht echte Begegnung – und damit Integration.
![]() Ein durchdachtes Konzept – Geflüchtete und Einheimische wohnen im 50:50-Verhältnis zusammen. Die Mieten sind erschwinglich, die Finanzierung langfristig gesichert.
Ein durchdachtes Konzept – Geflüchtete und Einheimische wohnen im 50:50-Verhältnis zusammen. Die Mieten sind erschwinglich, die Finanzierung langfristig gesichert.
![]() Mehr als nur Wohnraum – Zehn Stunden pro Monat engagieren sich die Bewohner:innen für die Gemeinschaft: Sie kochen, lernen und leben miteinander.
Mehr als nur Wohnraum – Zehn Stunden pro Monat engagieren sich die Bewohner:innen für die Gemeinschaft: Sie kochen, lernen und leben miteinander.
![]() Nachhaltiges Wachstum – Die Hoffnungsträger Stiftung investiert jährlich Millionen in den Bau neuer Hoffnungshäuser, um das Modell auszuweiten.
Nachhaltiges Wachstum – Die Hoffnungsträger Stiftung investiert jährlich Millionen in den Bau neuer Hoffnungshäuser, um das Modell auszuweiten.
Doch der Erfolg stößt auch auf Widerstände: Bürokratische Hürden, politische Blockaden und gesellschaftliche Vorbehalte bremsen den Ausbau.
Trotz allem: „Das Hoffnungshaus ist keine Konkurrenz um Wohnraum, sondern ein Mehrwert für die ganze Gesellschaft“, sagt Marcus Witzke, Vorstand der Hoffnungsträger Stiftung.
Mehr im Artikel auf brand eins